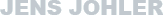Der Tagesspiegel
Sonntag, 8. August 1993 / Nr. 14 639 / Seite VII
Das Glück in der Nische
Jens Johler parodiert in kleinmeisterlichen Erzählungen die 68er / Von Tilman Krause
Wer erinnert sich noch an den Wettstreit zwischen "Kahlschlag" und "Kalligraphie"? Er tobte um 1950 in der deutschen Literatur. Die Vertreter des Kahlschlags nahmen die Trümmerwirklichkeit in den Blick. Angesichts der materiellen Not galt schon die Aneinanderreihung von Nebensätzen als kulinarisch. Man wollte syntaktisch karge Kost und fand, es komme vor allem darauf an, WAS man darstellt. Die "Kalligraphen" meinten, das WIE sei wichtiger. Wohlklang und Bilderreichtum schrieben sie auf ihre Fahnen, wobei sie stets mit einem Auge auf das "ewig Menschliche" schielten. Wäre damals ein Jens Johler unter ihnen gewesen, die Unversöhnlichen hätten sich schnell geeinigt. Der Berliner Autor nämlich verbindet beides: die genaue Schilderung des "WAS" - in seinem Falle der Mentalität einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe - mit einer geradezu selbstverliebten Gestaltung des "WIE". Es gibt keinen Chronisten der Achtundsechziger und ihrer augenblicklichen Befindlichkeit mit einem so ausgeprägten Gefühl für melodische Satzperioden, wohlgesetzte Pointen, hübsche Paradoxa.
Johlers Erzählungen "Ein Essen bei Victoria" sind blankgeputzte Kabinettstücke, fein ziseliert und durchwoben mit einer unaufdringlichen Ironie, die auch noch die genüßlichste Boshaftigkeit in ein mildes Licht taucht und im übrigen für Komik sorgt. Alltägliches, Alt-Bekanntes kommt uns in amüsanter Verpackung entgegen, und wir genießen es mit Behagen. Formal ist das alles ein bißchen altmodisch, Redseligkeit ist dem Autor nicht fremd. Wie er das Schürzen des Knotens auskostet, erinnert an Wilhelm Raabe, und auch die sonderlinsgshaften Charaktere, denen wir in diesem Buch begegnen, passen eher ins 19. Jahrhundert. Aber Vorsicht! Auch dies gehört zum Erzählverfahren, ist Ausdrucksmittel der Ironie: durch spitzweghaftes Pinseln in biedermeierlichem Kolorit parodiert Johler seine Helden - sanft, aber gerecht.
Denn Biedermeier - machen wir uns nichts vor - herrschte zur Zeit der Teilung im Westen dieser Stadt und herrscht dort auch noch. Johlers Alt-Achtundsechziger und ihre sozialen Nischen, ihre abgeschirmte Existenz in Bibliotheken oder alternativen Galerien: das ist stipendiengestützte Innerlichkeit, ein Leben von vollendeter sozialer Sorglosigkeit. Es wird hier in all seiner unfreiwillig komischen Provinzialität gezeigt. Allerdings, und das gereicht dem 1944 geborenen Johler zur Ehre, entlarvt dieser Zeitkritiker seine Generationsgenossen ohne eifernden Unterton.
Schon sein Ich-Erzähler, Mittvierziger und freier Journalist, ist eine typische Figur aus dem genannten Berliner Milieu: "Er hatte nicht getan, was er schon immer wollte, sondern erkennen müssen, daß er schon immer nichts gewollt hatte." Dieser Befund ist so nett gesagt wie vernichtend, denn er verweist im Grunde auf die Nutzlosigkeit dieser Existenz. Finanzielle Unabhängigkeit (Benjamin hat seine frühverstorbenen Eltern, Vertreter der Aufbau-Generation, beerbt) verbindet sich mit unermüdlicher Nabelschau. Sehnsüchtig wartet man auf die nächste Depression, die endlich für ein bißchen Abwechslung sorgt. Damit ist man natürlich nicht allein: auch die Leute aus Benjamins Umkreis betäuben ihre Langeweile durch Geselligkeit, suchen die gastronomischen Hangouts auf, reisen - immer ein wenig lustlos und enttäuscht, denn selbst in London oder Amerika ist das Glück gerade wieder weitergezogen, wenn man selbst endlich dort ankommt.
Am besten hat es da noch Erasmus, neben Benjamin die wichtigste Figur des Buches, weil der sein Wolkenkuckucksheim ohnehin stets mit sich führt. Dieser verkappte Homosexuelle, der jahrelang eine fremde Frau verehrt, ohne sie freilich je anzusprechen, lebt in einem imaginären 18. Jahrhundert. Er träumt von Grazie und Galanterie, weiß aber nicht, wie man einer Dame Blumen überreicht. Das ist für die Freunde erheiternd. Erasmus wird daher ständig eingeladen, und der Leser trifft ihn in fast jeder Erzählung. Gleichzeitig beneidet aber zumindest Benjamin ihn auch gewaltig, denn das gebildete Gequatsche von Erasmus hat die Qualität einer undurchlässigen Selbstinszenierung. Immerhin erfordert das hohe Disziplin - und daran mangelt es dem anderen. Darüber hinaus hat Erasmus, dieser moderne Mörike, geschafft, wozu es bei keinem sonst aus Johlers Universum reicht: er hat die Wirklichkeit erfolgreich dem Wahn geopfert und sich in seinem Orplid so gemütlich eingerichtet, daß ihn sein Lebensproblem längst nicht mehr bedrängt.
Aber man muß sich keine Sorgen machen: auch die anderen sind große Verdränger und werden über kurz oder lang sicher in ihr jeweiliges Traumreich abdriften. Im übrigen lassen sich für Nick, Renate, Victoria und wie sie alle heißen, wahrscheinlich ebenfalls historische Gestalten aus der Zeit des Vormärz finden, die ihnen Pate standen. Die Ereignisse von 1848 zerstörten (vorübergehend) die Lebensform der einen, diejenigen von 1989 lassen die anderen als überlebt erscheinen. Doch sie sind noch unter uns. Der Charme des Anachronistischen umweht sie, und hier haben sie einen liebevollen Porträtmaler gefunden.
Mit seinem neuen Buch stellt sich Jens Johler, der bisher vor allem als Verfasser von Theaterstücken mit viel Dialogwitz hervorgetreten ist, als Erzähler vor. "Ein Essen bei Victoria" tischt uns die kleinmeisterlichen Parerga und Paralipomena zu Peter Schneiders "Paarungen" auf. Ein wenig wehmütig sehen wir diesem Schmaus der 68er-Veteranen zu. Doch so freundlich uns die Lektüre auch stimmt, wir werden den Verdacht nicht los, daß es sich um den Verzehr ihrer wohlverdienten Henkersmahlzeit handelt.