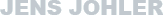Badische Zeitung
Die Achtundsechziger in den Vierzigern
"Bye bye, Ronstein": eine schwarze Komödie
Wilfried Ronstein, Anfang vierzig, blond, Goldrandbrille, ist Soziologe, Privatdozent. Lebt von den Einkünften seiner Frau, die als Architektin am Berliner Bau-Boom nicht schlecht verdient. Ab und zu schreibt er etwas für den "Merian" oder für "Abenteuer und Reisen". Und bietet alternative Stadtführungen an: auf den Spuren der Achtundsechziger, Krumme Straße, wo Benno Ohnesorg ermordet wurde, Audimax der TU, Tegeler Weg, die legendäre Apo-Schlacht, linke Kneipen und so weiter.
Da kommt das Angebot: eine Professur. Aber leider nur C 3. Und leider, leider nur Chemnitz. Gehen oder bleiben?
Wie Ronstein mit sich ringt und sich zum Gehen zwingt, sich in Aufbruchseuphorien schwingt und dann doch den Zug fahren läßt – und wie er am Ende von Ereignissen ganz anderer Art überrollt wird, das erzählen Jens Johler und Axel Olly in ihrem ersten gemeinsamen Roman auf hinreißend witzige und gewitzte Weise. Die Ronstein-Geschichte ist von Monologen der verschiedensten Figuren unterbrochen und bildet mit ihnen einen Berliner Reigen: Studentenbewegte und was aus ihnen geworden ist, Aufsteiger und Aussteiger, Traumtänzer und Karriereknechte. Ökosprüche auf den Lippen und das Handy in der Hosentasche. Achtundsechziger in den Vierzigern und natürlich nach wie vor aufs Unter-Dreißig-Sein trainiert.
Die beiden wissen, wovon sie reden: Axel Olly war im großen Jahr süße 17, ging vorzeitig von der Schule ab und wurde Kellner, Orangenpflücker, Protestsänger. Heute lebt er als Reiseleiter und -journalist mal in Berlin, mal auf Kreta. Und Jens Johler, anno 68 war er 24, hat bereits mit seinem Roman "Der Falsche" gezeigt, wieviel komisches Potential in jenen Jahren steckt, als ein spätzündender Molotowcocktail leicht zum Konterrevolutionär werden konnte.
"Der Falsche" war ein vergnügter Blick zurück auf die späten Sechziger, der "Ronstein" spielt heute. Und da sind die Möglichkeiten für ironische Brechungen ungleich größer. Ideale sind in die Jahre gekommen, Ziele zum Zitat verkommen – erkannt ist's natürlich längst, der Psycho- und Politjargon ist über sich selbst aufgeklärt, karikiert und persifliert bis in die dritte Potenz. Johler/ Olly treiben das Spiel der Brechungen bis in die Textur des Romans selbst: Wer da spricht, wer wen aus welcher Perspektive beschreibt, zeigt sich oft erst zehn, zwanzig Seiten später. Das macht neugierig, treibt den Roman voran.
Bis sich am Ende der szenische Reigen schließt und plötzlich klar wird, was jenes merkwürdige erste Kapitel mit Ronstein zu tun hat: Da erzählte ein Abiturient von einem langweiligen Sonntagnachmitag mit seinen beiden Skinhead-Freunden - ein Nachmittag, an dessen Ende in einer Falafelbude ein Mann niedergestochen wird. Anfang vierzig, blond, Goldrandbrille: Jetzt kennen wir ihn. Die Lakonie des Schülerberichts tritt in harten Kontrast zu den Befindlichkeitsreden der Altachtundsechziger, die schnellen Messerstiche verhöhnen Ronsteins bedächtiges Abwägen seiner Zukunft.
Draußen geht es härter zu: Das Schlußkapitel zeigt Streifenpolizisten als Kopfgeldjäger auf "Fitschis". Es ist eine kalte Zeit heute. Es war eine heiße Zeit damals. Bye bye, Ronstein.
GABRIELE SCHODER