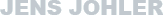Süddeutsche Zeitung
Eva Leipprand zu "Bye, bye, Ronstein"
Jens Johler/Axel Olly: Bye, bye, Ronstein
Spätestens seit den Erfolgen von Fruttero & Lucentini sind literarische Koproduktionen salonfähig. So hat auch Jens Johler, nach zwei eigenständig angefertigten Romanen, seine Komödie Bye, bye, Ronstein zusammen mit dem Reisejournalisten Axel Olly inszeniert. Schauplatz und Angelpunkt ist das wiedervereinigte Berlin nach der Wende. Die Stadt wird in einzelnen Szenen aus wechselnden Erzählperspektiven gezeigt; erst allmählich schält sich als wichtigster Handlungsträger Dr. Wilfried (Ronny) Ronstein heraus, Privatdozent der Soziologie. Der bekommt nun, nach jahrelangen beruflichen Durststrecken, die nur durch Gelegenheitsjobs und eine gutverdienende Ehefrau zu überbrücken waren, endlich eine Professur angeboten, in Chemnitz. Chemnitz klingt wie ein schlechtes DDRPutzmittel, der Beamtenstatus wie ein Todesurteil; der geheime Traum, Drehbuchschreiber zu werden, beginnt in einer Freiheitsgloriole zu leuchten. Neben anderen Alternativen taucht eine junge ansprechende Blondine auf. Ronstein, in jeder Beziehung unfähig, sich zu entscheiden, sucht Rat bei seinem Therapeuten. Er steigt dann nicht in den Zug nach Chemnitz, sieht sich aber auf einmal freier, als ihm lieb ist: bei seiner Rückkehr vom Bahnhof findet er Frau und Freund Öko-Ekki zusammen im Bett. Wird er nun endlich männlich handeln, statt einfach davonzuschleichen? Das bleibt offen. Am Schluß ist Ronsteins Story mit den eingeschobenen Szenen sehr geschickt, nach allen Regeln von Parallelle und Kontrapunkt, vernetzt, kriminalistisch angereichert und zudem noch leitmotivisch verklammert worden.
Was immer Axel Ollys Anteil an diesem leicht und unterhaltsam geschriebenen Roman ausmacht, Ronstein jedenfalls ist klar als typische Johler-Figur zu erkennen. Er weiß eigentlich nie, was er will, er nimmt sein Leben nicht in die Hand; in Alpträumen plagt ihn noch immer die panische Angst, durchzufallen. Er definiert sich selbst in erster Linie als Achtundsechziger. Immer noch klampft er gerne auf der Gitarre und erzählt von seinen Heldentaten in der Redaktion der Schülerzeitschrift in Bietigheim. Es wimmelt von Achtundsechzigern in diesem Buch: allesamt Söhne prügelnder Naziväter, haben sie den Antifaschismus wie einen Fluch zu tragen; sie sind gescheiterte, in ihrer Zeit hängengebliebene Intellektuelle, die den Sprung aus der Revolution in die Karriere nicht rechtzeitig geschafft haben und nun ohne Ideale und ohne Einkommen, jedoch laut jammernd herumjobben. Sie fühlen sich ausgeschmiert und pflegen ihre psychosomatischen Leiden. Sie lesen die taz und wollen eigentlich immer noch nicht wissen, daß es so etwas wie Rente gibt. Gewalt damals (revolutionär) und Gewalt heute (rechtsradikal) halten sie ganz selbstverständlich für zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Nicht einmal das Abpflücken von Mercedessternen ist mehr das, was es einmal war, zu unserer Zeit. Ronsteins Therapeut seziert weniger den Patienten als seine ganze Generation, die niemals wirklich dreißig geworden ist, die in pubertärem Größenwahn alles will, Freiheit und Geborgenheit gleichzeitig, und zwar umsonst. Gegenfigur ist der karrierewütige Yuppie, der Neunundachtziger, natürlich im Medienbereich tätig. Der wartet voller Verachtung darauf, daß die Gerontokratie endlich abtritt und die Schaltstellen der Macht seiner Generation freigibt.
Eine Frage, gerade heraus: sollte man diese Einteilung in Generationen jetzt nicht einfach einmal gut sein lassen? Sie nervt, weil ausgereizt, schon lange in Leitartikeln und Feuilletons, erst recht in Romanen wie diesem. Sie ist unfruchtbar und produziert zwangsläufig Klischees, weil sie die Figuren nur in ihrer Oberfläche erfaßt, wie Ausschneidepuppen, denen man verschiedene Kleider anhängen kann, ohne daß sie ihre Gesichter verziehen. Was damals Wohngemeinschaft und Pflastersteine waren, sind heute Party-Service, Corporate Identity und Prosecco. Es ist alles da, was heute einen Intellektuellen zu beschäftigen hat: Ökoseminare und Rote Socken, Skinheads und Asylanten, Ossis und Wessis, dazu Lammnüßchen, Aktivurlaub und Pitbull-Kampfhunde. Das Klischee bringt keinen Erkenntniszugewinn, auch in der satirischen Überspitzung nicht. Natürlich ist in diesem Buch alles nicht so ernst gemeint, aber es ist auch nicht gar nicht ernst gemeint. So wie die Therapiesitzung (inzwischen, wie es scheint, in zeitgenössischen Romanen ein unverzichtbarer Topos): durch die Satire hindurch ist die Freude an der späten Rache zu spüren - endlich, mit der Feder, Gewalt über den Therapeuten zu haben. Dem hier geschieht es recht; er hat mit dem Achtundsechziger-Etikett den Blick auf Ronny Ronstein selber zugeklebt.
Rezensenten dürfen etwas, das Therapeuten nicht gestattet ist: klare Empfehlungen geben. Also zum Beispiel diese: doch endlich das, was in diesem Roman an Sprachwitz und dramaturgisch-komödiantischem Talent versammelt ist, einem neuen Thema zuzuführen.